Albert Einstein und Ulm
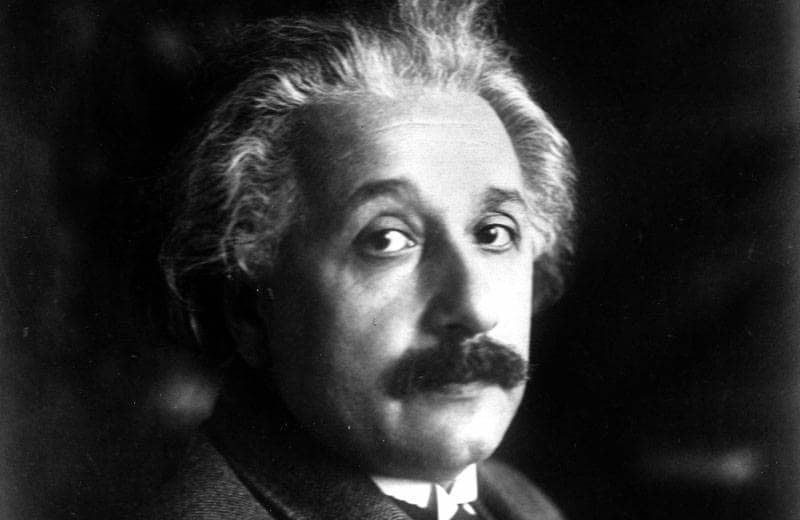
© Ullsteinbild
Albert
Einstein. Mehr als nur ein Name. Physiker. Genie. Popstar der Wissenschaft.
Philosoph und Humanist. Weltversteher und Welterklärer. Auf Augenhöhe mit
Kopernikus, Galilei oder Newton.
Und:
Albert Einstein - Ulmer!
Der
wohl bekannteste Wissenschaftler unserer Zeit wurde tatsächlich am 14. März
1879 in der Bahnhofstraße 20 in Ulm geboren. Albert Einstein lebte nur 15
Monate in der Donaustadt. Seine weit verzweigte Familie jedoch - 18 Cousins und
Cousinen Einsteins lebten zeitweise in Ulm - war ein angesehenes und fest
verwurzeltes Mitglied der Stadtgesellschaft. Was vielleicht auch die dauerhafte
Verbundenheit Einsteins mit seiner Geburtsstadt erklärt, die er in einem Brief an die Ulmer Abendpost am 18. März 1929, kurz nach seinem 50. Geburtstag, folgendermaßen
beschrieb:
„Die Stadt der Geburt hängt dem Leben als etwas ebenso Einzigartiges an wie die Herkunft von der leiblichen Mutter. Auch der Geburtsstadt verdanken wir einen Teil unseres Wesens. So gedenke ich Ulms in Dankbarkeit, da es edle künstlerische Tradition mit schlichter und gesunder Wesensart verbindet."
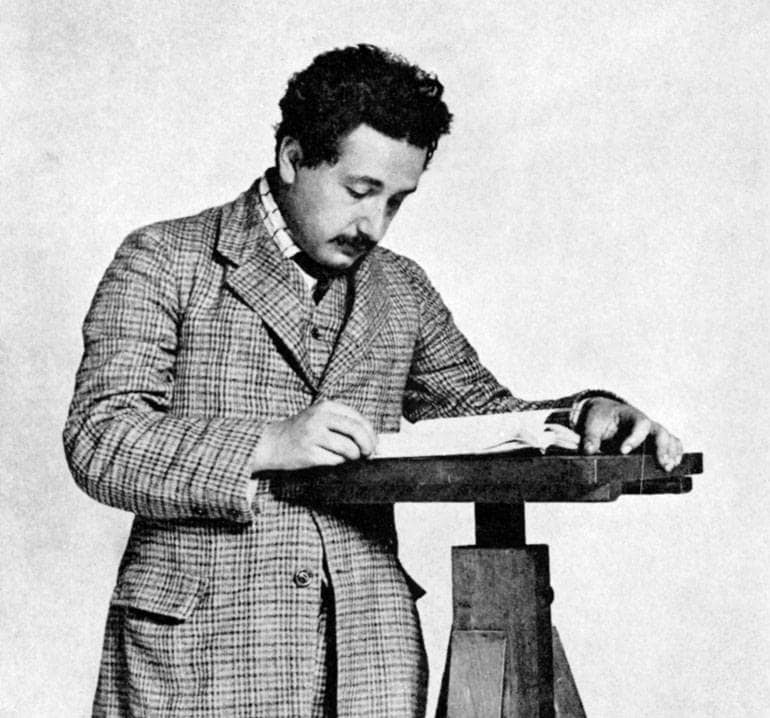
© ullstein bild - Heritage Images
War
Einstein ein "Jahrhundert-Physiker"? Daran besteht kein Zweifel. Im "Wunderjahr"
(Annus mirabilis) 1905 veröffentlichte er neben seiner Dissertation vier bahnbrechende
Arbeiten. Jede einzelne von ihnen war nobelpreiswürdig und hätte ihn zu einem Physiker
von Weltrang gemacht: die spezielle Relativitätstheorie, die Lichtquantenhypothese
("Der photoelektrische Effekt", für die er 1922 den Nobelpreis
erhielt), die Bestätigung des molekularen Aufbaus der Materie durch
die "Brownsche Bewegung" und die quantentheoretische Erklärung der
spezifischen Wärme fester Körper.
Jede dieser Arbeiten begründete eine völlig
neue Sichtweise auf dem jeweiligen Gebiet der Physik - und zusammen lösten sie
alle Probleme, Rätsel und Widersprüche der klassischen Physik auf. Eine
sagenhafte, in der modernen Wissenschaft einzigartige Leistung, die er "nach
Feierabend"- zu
dieser Zeit war der erst 26-jährige Einstein in Vollzeit am Patentamt in Bern
beschäftigt - vollbringt. Mit
Bleistift und Papier und ohne den Apparat einer Universität, ohne Assistenten,
Labor und Fachbibliotheken.
Einsteins
physikalische Problemstellungen haben um die Jahrhundertwende auch
zahlreiche
andere bedeutende Wissenschaftler bewegt. Keinem seiner Kollegen jedoch gelang
es in ähnlicher Weise die Vielfalt der Naturerscheinungen als einen
einheitlichen Zusammenhang zu denken, davon allgemeine Prinzipien abzuleiten
und die „Einheit der Natur“ in mathematische Formeln zu übersetzen. Damit wurde
Albert Einstein zum Begründer des modernen naturwissenschaftlichen Weltbildes.
Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts stand eben dieser Weltbildbegriff im Fokus naturwissenschaftlichen
Arbeitens. Die Lösung von physikalischen Teilproblemen sollte letztlich in eine
zusammenfassende Darstellung der Welt, wenn man so will, in eine
"Weltformel" münden. Einstein verschrieb sich wie kein anderer diesem
ganzheitlichen Ansatz. Die Formulierung der "Allgemeinen Relativitätstheorie"
im Jahr 1916 war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.
Die
letzten 20 Jahre seines Lebens beschäftigte er sich mit der "Einheitlichen
Feldtheorie". Ziel war es, eine Theorie zu formulieren, in der
die Gravitation und andere Wechselwirkungen, insbesondere
der Elektromagnetismus, in einheitlicher Weise beschrieben werden. Einstein gelang dies
bis zu seinem Tode nicht. Überhaupt den Versuch unternommen zu haben, entsprach
aber seinem eigenen Anspruch an die Wissenschaft.
Zu sagen,
Einstein war seiner Zeit voraus, wäre eine maßlose Untertreibung. Ein Beispiel
gefällig? Es dauerte sage und schreibe 99 Jahre - in der Wissenschaft eine
Ewigkeit - bis es Forschern 2015 gelang, Gravitationswellen zu messen und damit
endlich zu beweisen, was Einstein bereits 1916 wusste.
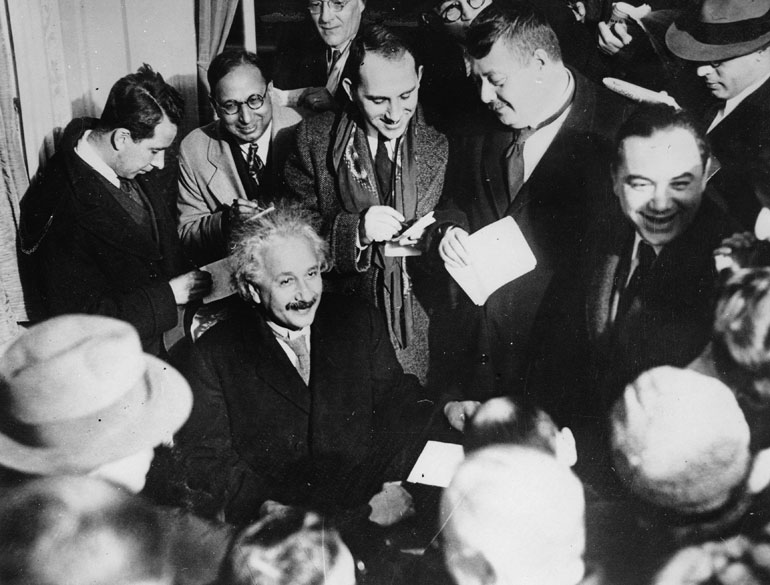
© ullstein bild - Imagno
War
Einstein ein "Nerd"? Als Wissenschaftler, ja! Er bewegte sich
gedanklich in Themengebilden und physikalischen Welten, die kein anderer in seiner
Zeit zu erschließen vermochte.
Als
Mensch war er jedoch alles andere als einseitig interessiert. Einstein zeigte
bereits früh Interesse an Philosophie, hatte eine Leidenschaft für Literatur
und Musik. Er war zwar nicht im eigentlichen Sinne gesellig, aber doch gerne in
Gesellschaft anderer Menschen. Heute würde man ihn wohl einen Bildungsbürger
nennen oder einen Humanisten.
Einsteins
wissenschaftliche Hypothese, dass alle Phänomene der Natur in Verbindung
zueinander stehen und nur in ihrer Gesamtheit ihre Wirkung entfalten, übertrug
er auch auf gesellschaftliche und politische Fragen. Er formulierte Ideen zu
Regierungs- und Wirtschaftsformen, äußerte sich zu ethischen und philosophischen
Fragen, prangerte wiederholt nationalistische, rassistische und militaristische
Tendenzen öffentlichkeitswirksam an. Einstein war ein zutiefst moralischer
Mensch, der die Verantwortung der Wissenschaft gegenüber der Menschheit sehr
ernst nahm. Forschung um der Forschung willen, ohne ethisches Fundament, war
für ihn undenkbar. Das führte ihn im Jahr 1939 in ein moralisches Dilemma. Nach
Otto Hahns erfolgreicher Kernspaltung im Jahr zuvor, befürchtete er den Bau
einer atomaren Waffe durch das nationalsozialistische Deutschland. Der Pazifist
Einstein entschloss sich schweren Herzens, einen Brief an den amerikanischen
Präsidenten Franklin D. Roosevelt zu unterzeichnen, der diesen aufforderte, den
Bau einer Atombombe zu veranlassen. Einstein selbst war nach heutiger
Quellenlage nicht aktiv an der Entwicklung beteiligt - an der moralischen Mitverantwortung
trug er dennoch bis zu seinem Lebensende schwer.
Albert
Einstein leistete mit seinem Lebenswerk einen unschätzbar großen Beitrag dazu, uns
unsere Welt besser verstehen zu lassen. Und er kämpfte gleichzeitig leidenschaftlich
dafür, das Leben auf ihr zu verbessern. Das war sein fundamentales Alleinstellungsmerkmal
als Forscher. Diese beispielgebende Kombination aus wissenschaftlicher Brillanz
und Moralität ist wohl auch ein wesentlicher Grund für seine bis heute
ungebrochene Popularität.
Ist damit
das Phänomen Einstein umfassend erklärt? Natürlich nicht. Albert Einstein hatte
so viele Facetten, so viele Talente und Fähigkeiten. Nur die Gesamtheit aller
ergibt das komplette Bild. Nur die Gesamtheit. Wie eben auch bei Einsteins
grundsätzlicher Idee von der Physik und unserer Welt. Zufall? Vielleicht.
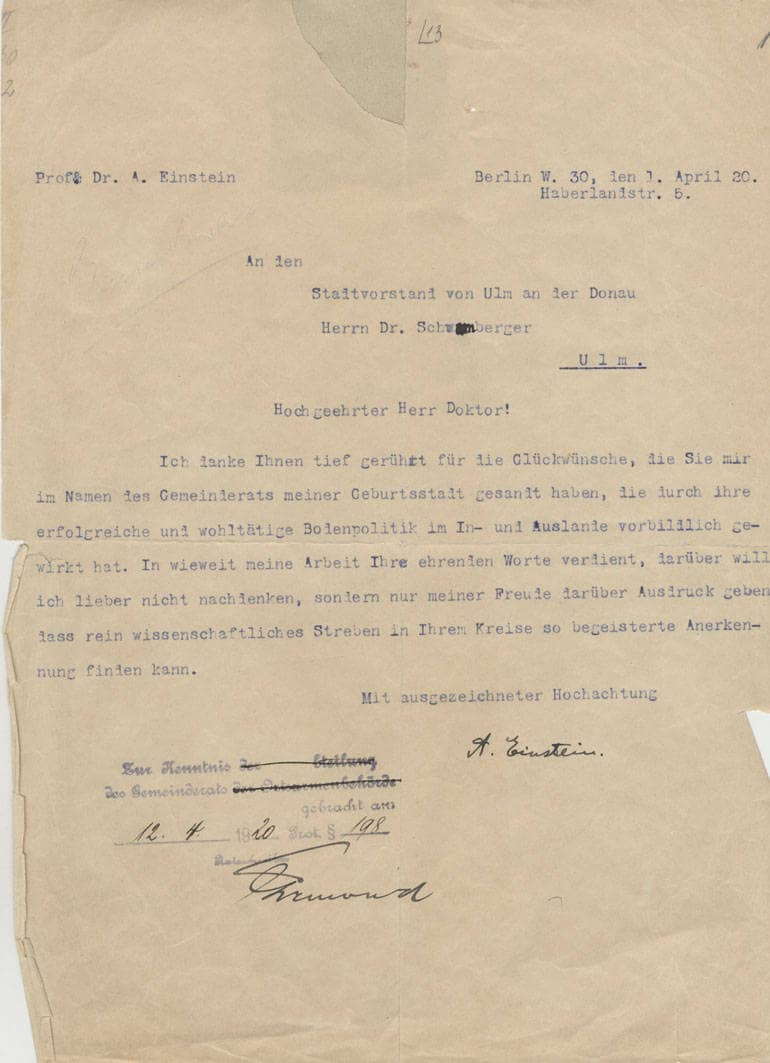
Das
Verhältnis Albert Einsteins zu Ulm könnte man als reserviert, aber höflich
beschreiben. Was nicht allzu sehr verwundern mag: Einstein lebte bekanntlich
nur 15 Monate hier und hatte wohl keine Erinnerung an seine Zeit in Ulm.
Reserviert wohl aber auch, weil er sich generell nicht viel aus weltlichen
Ehrungen machte. Als ihm die Stadt Ulm im Jahre 1920 "Glückwünsche der
Stadt" übermittelte - immerhin noch zwei Jahre bevor ihm der Nobelpreis
verliehen wurde - antwortete Einstein in einem Dankesschreiben und lobte darin
die „erfolgreiche und wohltätige
Bodenpolitik" Ulms, die „im In- und Auslande vorbildlich gewirkt
hat".
Die erste Interaktion zwischen Stadt und
ihrem berühmtesten Sohn "lief also nicht schlecht". Auch auf die
Benennung einer Straße Ulms mit seinem Namen, die ihm die Stadt in einem
Glückwunschschreiben zu seinem 50. Geburtstag mitteilte, reagierte der
Nobelpreisträger 1929 artig und mit dem ihm eigenen Humor: „Von der nach mir
benannten Straße habe ich schon gehört. Mein tröstlicher Gedanke war, dass ich
ja nicht für das verantwortlich bin, was darin geschieht."
Machtergreifung der
Nationalsozialisten im 1933 - alles ändert sich
Diese
höfliche, wenngleich auch eher oberflächliche Interaktion, kam im Jahr 1933 an
ihr jähes Ende. Die Nationalsozialisten übernahmen die Macht in Deutschland. Der
Jude Albert Einstein hatte bereits früh vor diesen faschistischen Tendenzen gewarnt
und kehrte von einer Vortragsreise in den USA, wo er seit 1930 drei Monate pro Jahr in Princeton lehrte, nicht mehr
zurück.
Bereits im März 1933 veröffentlichte er
folgendes "Bekenntnis":
„Solange mir eine Möglichkeit offen steht, werde ich mich nur in
einem Lande aufhalten, in dem politische Freiheit, Toleranz und Gleichheit
aller Bürger vor dem Gesetze herrschen. Zur politischen Freiheit gehört die
Freiheit der mündlichen und schriftlichen Äußerung politischer Überzeugung, zur
Toleranz die Achtung vor jeglicher Überzeugung eines Individuums.
Diese Bedingungen sind gegenwärtig in Deutschland nicht erfüllt. Es werden dort
diejenigen verfolgt, welche sich um die Pflege internationaler Verständigung
besonders verdient gemacht haben, darunter einige der führenden Künstler. Wie
jedes Individuum, so kann auch jeder gesellschaftliche Organismus psychisch
krank werden, besonders in Zeiten erschwerter Existenz. Nationen pflegen solche
Krankheiten zu überstehen. Ich hoffe, dass in Deutschland bald gesunde Verhältnisse
eintreten werden und dass dort in Zukunft die großen Männer wie Kant und Goethe
nicht nur von Zeit zu Zeit gefeiert werden, sondern dass sich auch die von
ihnen gelehrten Grundsätze im öffentlichen Leben und im allgemeinen Bewusstsein
durchsetzen."
Die nationalsozialistischen Machthaber in
Ulm reagierten: Noch im gleichen Monat wurde die Einsteinstraße in
"Fichtestraße" umbenannt. Im folgenden Jahr wurde Albert Einstein die
deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt.
Drehte
sich der Konflikt zwischen Einstein und seinem Geburtsland zu Beginn also mehr
oder weniger ausschließlich um politische Fragen, wurden die Probleme der Juden
in Deutschland in den kommenden Jahren wesentlich existenzieller. 1933 bereits
begannen die Boykotte gegen jüdische Geschäfte, 1935 folgten die "Nürnberger
Gesetze" (Rassengesetze) und 1938 die Reichspogromnacht. In welch
unvorstellbarer Grausamkeit, dem Holocaust, diese Entwicklungen letztendlich
münden sollten, war damals jedoch scheinbar nicht für alle Betroffenen absehbar.
Und doch wandten sich bereits in den Jahren vor Ausbruch des 2. Weltkriegs eine
ganze Reihe Ulmer Verwandte an Einstein und baten um Hilfe. Einstein tat was er
konnte, lieferte Bürgschaften, verfasste Empfehlungsschreiben und half auf
diesem Weg vielen Familienmitgliedern, Deutschland noch vor Beginn der Katastrophe
wohlbehalten zu verlassen. Für Lina Einstein, Bertha Hofheimer, Marie Wessel, Hugo
Moos und Julius Moos - allesamt Cousinen und Cousins von Albert Einstein - gab
es allerdings keine Rettung. Sie wurden von den Nationalsozialisten ermordet.
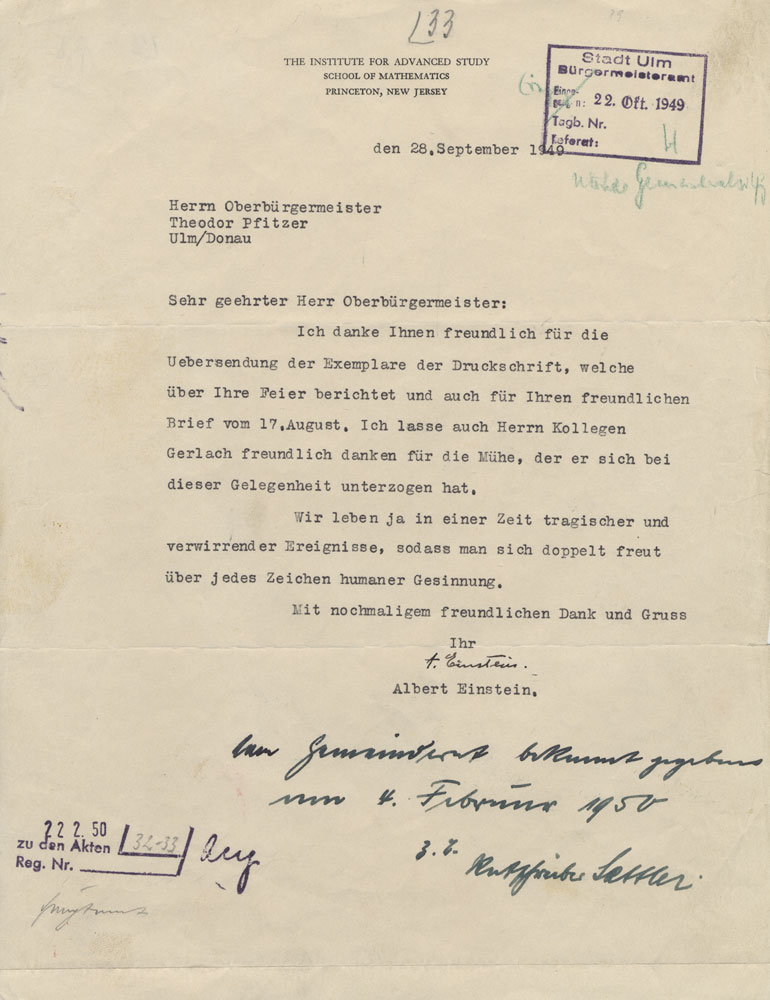
Bereits
kurz nach Kriegsende, im Juli 1945, wurden in Ulm die Straßennamen wieder
umbenannt und damit versucht, die Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus
aus dem Stadtbild zu entfernen. Aus der Fichtestraße wurde wieder die
Einsteinstraße. Einstein soll ein Jahr später davon erfahren und im Scherz
vorgeschlagen haben: "Man sollte einen neutralen Namen wie
"Windfahnenstraße" wählen - das wäre dem politischen Wesen der
Deutschen besser angepasst und benötigte keine Umtaufen im Laufe der
Zeit".
Von
Seiten der Ulmer Stadtverwaltung gab es in den folgenden Jahren immer wieder
Versuche, die Beziehungen zu Albert Einstein zu verbessern. Wollte man Schuld
wiedergutmachen? Wollte man unterbewusst eine Art Absolution erwirken? Oder war
es der ehrliche Versuch, nach zwölf Jahren unfassbarer Verbrechen, endlich wieder
das Richtige zu tun? Wahrscheinlich war es eine Kombination aller dieser
denkbaren Beweggründe. Aus heutiger Sicht mag es eher überraschen, dass
Einstein so kurz nach dem Holocaust überhaupt dazu bereit war, die
Kommunikation mit der Stadt Ulm wieder aufzunehmen. Doch er tat es. Er
antwortete stets auf die jährlich von der Stadt an ihn gesendeten
Geburtstagsglückwünsche. Zwar lehnte er die Annahme der Ehrenbürgerschaft mit
dem Hinweis auf die im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen an seinen
Glaubensbrüdern ab. Er tat dies aber mit einem persönlichen, vertraulichen
Brief an den Oberbürgermeister und ersparte den Ulmer Stadtoberen damit eine
öffentliche Zurechtweisung.
Als
er sich 1949 beim damaligen Oberbürgermeister Theodor Pfizer für die
Übersendung einer Broschüre über die Feierstunde zu
seinem 70. Geburtstag schriftlich bedankte, kann man vorsichtig versöhnliche
Töne heraus hören: „Wir leben ja in einer Zeit tragischer und verwirrender
Ereignisse, sodass man sich doppelt freut über jedes Zeichen humaner
Gesinnung."
Wahr ist
aber auch, dass Einstein Ulm nie wieder betreten hat. Man mag es sehr gut
verstehen.

Ulm hat Albert Einstein nicht vergessen.
An mehreren Stellen in der Stadt erzählen öffentliche Gebäude, Denkmäler oder
Kunstobjekte seine Geschichte.
Das EinsteinHaus beispielsweise - Heimat der Ulmer Volkshochschule. Einsteins
Eintreten für die individuelle Unabhängigkeit und den Weltfrieden, seine
Menschlichkeit und wissenschaftlichen Leistungen sollten zum Vorbild für den
Geist der Volkshochschule werden. Seit der Eröffnung des EinsteinHauses 1968
befindet sich im ersten Stock eine Dokumentation mit Bildern aus dem Leben
Einsteins.
Auch Max Bill - Gründungsrektor der
Hochschule für Gestaltung (HfG) - beschäftigte sich mit der Erinnerung an den
großen Physiker. Das von ihm gestaltete Denkmal befindet sich in der Nähe von
Einsteins Geburtshaus. Je zwölf stehende Steine symbolisieren die Tagstunden
und zwölf liegende Steine die Nachtstunden.
Weitere Reminiszenzen wie der Brunnen am
Zeughaus, die Einstein-Gedenkplatte oder das Glasfenster im Münster zeichnen das
Einstein-Bild in Ulm.

Im Gebäude auf dem Weinhof 19, dem sogenannten "Engländer", wohnte Einsteins Großmutter Helene.
Aber ist das Bild vollständig? Ist es
einer Person von der geschichtlichen Bedeutung eines Albert Einstein
angemessen? Tatsächlich hat sich Ulm mit einer klaren, stringenten Würdigung
seines berühmtesten Sohnes bis dato schwer getan. Aber mag das verwundern? Wie
wird man dem Erbe einer Person der Zeitgeschichte gerecht ohne Gefahr zu laufen,
sich selbst zu beweihräuchern? Wir reden immerhin von "nur" 15
Monaten, die der geniale Physiker in Ulm verbrachte. Wie viel Ulmer ist Albert
Einstein?
Ähnliche Fragen mussten sich auch die Menschen in Bern stellen, wo Einstein einst gearbeitet hat. Ebenso die Verantwortlichen der Princeton University, wo er lehrte, und diejenigen der Hebrew University in Jerusalem, die seinen Nachlass verwalten. Sie alle fanden auf ihre eigene Art und Weise eine Antwort.
Auch Ulm wird eine Antwort finden. Mit einem Museum im sogenannten "Engländer", in dem Einsteins Großmutter Helene in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte. Das Museum wird voraussichtlich 2024 öffnen. Dafür erforscht das Stadtarchiv Ulm die Beziehung von Einstein zu seiner Heimatstadt und die Verbindungen zu seiner in der Region tief verwurzelten Verwandtschaft. Diese Verbindungen werden in vielen Briefen Einsteins sichtbar. Das Stadtarchiv verfügt über eine Sammlung solcher Briefe, die zuletzt um einen Brief aus dem Jahre 1940 erweitert wurde. Neueste Untersuchungen der Historiker zeigen unter anderem auch, dass Einstein in seinem Geburtshaus in der Bahnhofstraße am 21. März nach jüdischem Brauch durch S.W. Strauß aus Laupheim unter Beisein seines Vaters und seiner Großmutter Helene beschnitten wurde.
Generell gilt: Das Erbe des Mannes, der uns das Verhältnis von Raum und Zeit erklärte, hat ohnehin keinen festen Platz oder Ort! Sein Vermächtnis ist in den Köpfen der Menschheit zu Hause.
Und doch steht Ulm in der Pflicht. Hier ist er geboren. Hier war seine Familie zu Hause. Natürlich müssen wir seine Geschichte erzählen. Damit viele Generationen nach uns sie erfahren können. In Ulm - am Ort wo am 14. März 1879 alles begann.
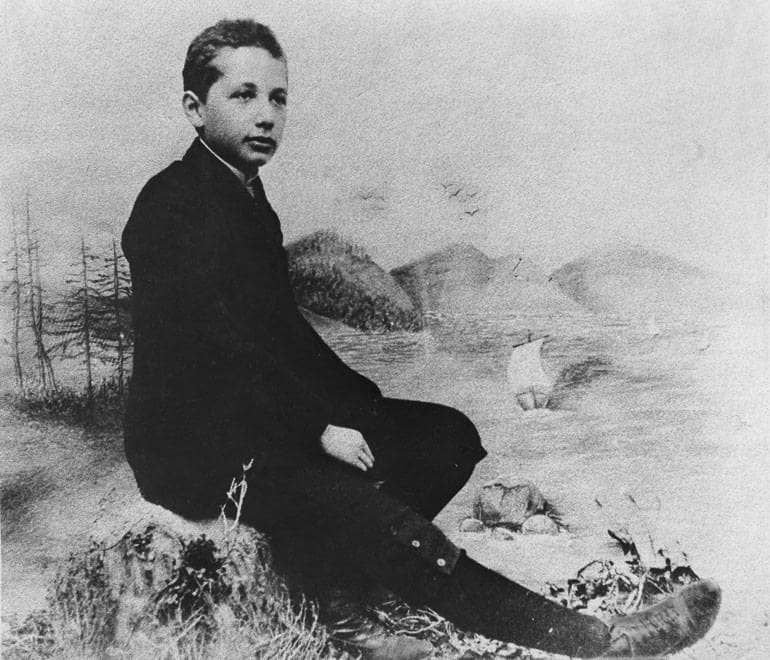
© ullstein bild - ullstein bild
Die
weit verzweigte Familie Einstein stammte ursprünglich aus Kappel und Buchau, wo
die Großeltern des berühmten Physikers lebten. In Buchau bekam das Ehepaar
Abraham und Helene Einstein in den Jahren zwischen 1841 und 1855 die sechs
Kinder August Ignaz, Jette, Heinrich, Hermann, Jakob und Friederike. Nach ihrer
Hochzeit mit Kosman Dreyfuss zog Jette als erstes Familienmitglied der
Einsteins 1864 nach Ulm. Bald schon folgten ihre Eltern und die meisten ihrer
Geschwister, auch Hermann Einstein. Spätestens seit seiner Heirat mit der in
Cannstatt geborenen Pauline Koch war er als Kaufmann in der Bettfedernhandlung
„Israel und Levi“ am Weinhof 19 in Ulm tätig. Die einzelnen Familienmitglieder
knüpften in der neuen Heimatstadt schnell Kontakte und engagierten sich in der
Gesellschaft. Als die jüdische Gemeinde anlässlich der 500. Wiederkehr der Grundsteinlegung
des Münsters 1877 die Jeremias-Figur für die evangelische Kirche stiftete,
beteiligten sich auch Hermann Einstein, August Einstein und deren Schwager
Kosman Dreyfuss an der Spendenaktion. Kosman Dreyfuss gehörte sogar dem dazu
eigens eingerichteten Komitee an. Verwandtschaftlich verbunden waren die
Einsteins in Ulm mit den Familien Dreyfuss, Hofheimer, Wessel, Steiner, Hirsch
und Moos.
Am
14. März 1879 kam Albert Einstein in der Bahnhofstraße 20 als erstes Kind von Hermann
und Pauline Einstein zur Welt. Bereits im Juni 1880 verließ die junge Familie
die Stadt Ulm in Richtung München, wo im folgenden Jahr die Tochter Maja
geboren wurde. Bis auf Verwandtschaftsbesuche und Schriftwechsel mit der Stadt
endete das Ulmer Kapitel von Albert Einstein recht bald. Nicht jedoch für die zahlreichen
Verwandten des späteren Nobelpreisträgers, denn mindestens vier Tanten und Onkel
lebten hier und es wurden 18 Cousinen und Cousins in Ulm geboren. Die überwiegende
Mehrzahl von ihnen wuchs hier auf und verbrachte ihr Erwachsenenleben in Ulm.
Kosman Dreyfuss, der Ehemann von Albert Einsteins Tante Jette, wurde nur wenige
Jahre nach seiner Ankunft in Ulm zum Vorsitzenden des Israelitischen Vorsteheramtes
gewählt. Ihm wurde die Ehre zu Teil, den Schlüssel für die Synagoge vom Bauherrn
in Empfang zu nehmen. Auch die Familie Adolph und Friederike Moos zählte zu den
angesehenen Bürgern der Stadt. Ein schweres Los traf Lina Einstein, eine von
drei Töchtern des Ehepaares August und Bertha Einstein. Innerhalb weniger Jahre
verstarben ihre Eltern und ihre beiden Schwestern. Lina Einstein blieb
unverheiratet und war nach 1933 auf die Wohlfahrt der israelitischen Gemeinde
angewiesen. Nachdem eine Auswanderung nicht zu Stande gekommen war, wurde sie
am 22. August 1942 nach Theresienstadt und von dort nach Treblinka deportiert,
wo sie unmittelbar nach der Ankunft in einer Gaskammer ermordet wurde. Albert
Einstein selbst versuchte, seinen Verwandten in der Zeit der Verfolgung und Not
zu helfen und schrieb zahlreiche Empfehlungsschreiben. Vielen
Familienmitgliedern gelang es, aufgrund solcher „affidavits of support“ oder
auf anderem Wege, Deutschland zu verlassen. Für Lina Einstein, Bertha
Hofheimer, Marie Wessel, Hugo Moos und Julius Moos, allesamt Cousinen und
Cousins von Albert Einstein, gab es jedoch keine Rettung. Albert Einstein selbst
hatte 1933 Deutschland verlassen und war nach einer Vortragsreise in den Vereinigten
Staaten geblieben. Bereits am 20. März 1933 wurde in Ulm die nach Einstein
benannte Straße in Fichtestraße umbenannt. Kurze Zeit später wurde ihm die
deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.

© DZOK
Nur
ein Jude kehrte nach Ende des zweiten Weltkriegs freiwillig nach Ulm zurück:
Alfred Moos, der Großneffe Albert Einsteins. Moos war bereits in jungen Jahren
politisch aktiv und hatte sich als Jura-Student zunächst der SPD angeschlossen.
Später wechselte der zur KPD-nahen "Roten Studentengruppe". Moos
verließ auf Vermittlung Albert Einsteins Deutschland bereits 1933. Zunächst
hielt er sich in London auf, später emigrierte er nach Palästina.
Warum er
1953 nach Ulm zurückkehrte? "Ich habe den Glauben an eine bessere und
schönere Welt des Friedens nie verloren. Der Wunsch nach Vergebung und Versöhnung hat
mich nach Ulm zurückgeführt", sagte er über seine Motive. Die Stadt Ulm
würdigte Moos' lebenslangen Einsatz für Frieden und Freiheit mit der Verleihung
der Bürgermedaille 1988. Und 2007, zehn Jahre nach seinem Tod, wurde ein Weg
nach Moos benannt. Der Alfred-Moos-Weg führt durch den Alten Friedhof, am alten
jüdischen Friedhof vorbei und mündet in die Friedensstraße. Viel passender
hätte man sein Lebenswerk nicht würdigen können.
